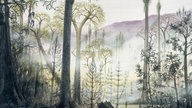So entstehen Fossilien
Planet Wissen. 02:45 Min.. Verfügbar bis 26.09.2027. WDR. Von ZDF/Terra X/Spiegel TV/Jens Nicolai/Oliver Roetz/Hauke Ketelsen/Richard Sako https://terraxplaincommons.zdf.de.
Deutschland in der Urzeit
Fossilien – Spuren im Stein
Fossilien sind Versteinerungen ausgestorbener Pflanzen und Tiere. Mit ihrer Hilfe versuchen Forscher zu ergründen, wie sich das Leben vom Einzeller zu komplexeren Formen entwickelt hat. Dabei helfen ihnen auch lebende Fossilien, die sich seitdem kaum verändert haben.
Von Ernst Pattas
Wie entstehen Fossilien?
Schon die alten Griechen hatten erkannt, dass alle Erscheinungen einer ständigen Veränderung unterliegen. Später fand man in Steinbrüchen die Abdrücke von Muscheln, Fischen und anderen Tieren, darunter solche, die es in dieser Form nicht mehr lebendig gab.
Eine Wissenschaft begann, die Geheimnisse ausgestorbener Lebensformen zu ergründen: die Paläontologie. Sie stützt sich vor allem auf Fossilien (lat. fossilis = ausgegraben), Versteinerungen von Organismen aus vergangenen Erdzeitaltern. Diese helfen ihr, ein ungefähres Bild von der Entwicklung der Natur zu gewinnen.

Versteinerung eines Ammoniten
Versteinerungen ausgestorbener Pflanzen und Tiere geben Auskunft über das Alter und die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf unserem Planeten. Solche Fossilien entstehen vor allem dann, wenn absterbende Tiere oder Pflanzen auf den Boden sinken und von Ablagerungen bedeckt werden. Während sich die Weichteile des Körpers zersetzen, bleiben das Skelett oder der Panzer erhalten.
Luftdicht abgeschlossen versteinern sie unter dem wachsenden Druck der darüber lagernden Erdschichten, bis sie durch Zufall (Erdarbeiten, Kohlebergbau) wieder ans Tageslicht kommen. Kleine Lebewesen können auch durch das versteinerte Harz der Bäume (Bernstein) oder im ewigen Eis eingeschlossen sein und so für Millionen von Jahren konserviert werden.

Bernstein mit eingeschlossenem Insekt
Kalender der Vergangenheit
Der Paläontologe interessiert sich zunächst vor allem für das Alter eines Fossils. Dazu untersucht er den Ort und die Tiefe, in der es gefunden wurde. Die einzelnen Erdschichten sind eine Art geologischer Kalender. In der Regel gilt: Je tiefer das Fossil vergraben war, desto älter ist es auch.
Genauere Erkenntnisse gewinnt man durch die sogenannte C14-Methode. Die Atome dieser Kohlenstoffgruppe nehmen mit einer messbaren Geschwindigkeit ab, sobald ein Organismus gestorben ist. Nach 5570 Jahren ist genau die Hälfte der Atome zerfallen (Halbwertszeit). Mit dieser Methode kann man etwa 30.000 Jahre überblicken, mit einer Unschärfe von etwa 1000 Jahren.
Weiter zurück in die Vergangenheit führt die Zerfallszeit des Uran, das im Gestein enthalten ist. So glauben die Forscher, dass das Leben auf unserer Erde vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist.

Freigelegte Ammoniten und Belemniten in einer Steinplatte
Aufstieg und Fall
Sobald er das Alter eines Fossils ermittelt hat, vergleicht es der Paläontologe mit anderen Funden. Dabei ergeben sich Informationen über die Verbreitung eines Lebewesens, seine Verwandtschaft mit anderen Lebewesen und seine Veränderungen im Laufe der Zeit.
So entsteht ein weit verzweigter Stammbaum der erforschten Lebewesen. Er macht ihre Entwicklungslinien anschaulich und zeigt, dass Arten, die auf den ersten Blick scheinbar nichts miteinander zu tun haben, genetisch verwandt sind und gemeinsame Vorfahren haben.
Man kann gut erkennen, dass fast alle Arten ihre Hochzeiten hatten, das heißt Perioden, in denen sie sich besonders erfolgreich behaupten und vermehren konnten. Dann genügte vielleicht ein Klimawechsel (Eiszeit) oder eine kosmische Katastrophe (zum Beispiel der Einschlag eines großen Meteoriten), um sie zu vernichten. Viele Arten sind inzwischen ausgestorben, wahrscheinlich mehr als heutzutage noch existieren.
(Erstveröffentlichung 2010. Letzte Aktualisierung 14.07.2020)
Quelle: WDR